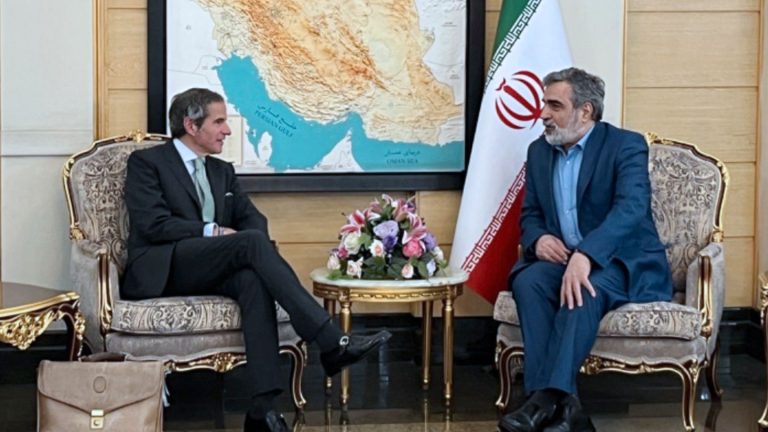Viele hoffen auf ein Verbot der AfD – aber das ist gar nicht so einfach. SPD-Chefin Esken ruft die zuständigen Minister noch einmal dazu auf, Beweise zu sammeln.
SPD-Chefin Saskia Esken hat die Innenminister dazu aufgerufen, Material für ein mögliches Verbot der AfD zu sammeln. „Ich erwarte, dass die Innenminister von Bund und Ländern die Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter zu den extremistischen Bestrebungen der AfD weiterhin zusammentragen sowie gegebenenfalls Verfahren – beispielsweise bei der Unterbindung von Finanzströmen rechtsextremer Netzwerke – einleiten“, sagte Esken dem „stern“.
„Weiter will ich davon ausgehen und erwarte es auch, dass die antragsberechtigten Verfassungsorgane für ein Parteiverbot, also Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat, sich fortlaufend über die Erkenntnisse informieren lassen“, so die Parteichefin.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte erklärt, dass ein AfD-Verbotsverfahren derzeit zu riskant sei. Es lägen nicht genug Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD vor. Ein Parteienverbot kann von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden. Der AfD müsste in dem Verfahren nachgewiesen werden, dass sie aggressiv kämpferisch gegen die Verfassung vorgeht.
Die AfD war bei der Landtagswahl in Thüringen stärkste Kraft geworden – das erste Mal bei einer Landtagswahl in Deutschland überhaupt. Der Verfassungsschutz hat sie dort wie auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Kritiker warnen, dass ein Verbotsverfahren sehr langwierig und der Ausgang in Karlsruhe offen wäre. Zudem gibt es Bedenken, eine Partei mit hoher Wählerzustimmung zu verbieten.
So sieht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen etwaigen AfD-Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht skeptisch. „Was ich wollen würde, ist nicht vordringlich“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Entscheidend ist, was an beweisbaren und gerichtsfesten Unterlagen vorgelegt werden kann.“ Politiker seien bei einer solchen Debatte zudem „immer in Gefahr, als Konkurrenten zu erscheinen“.