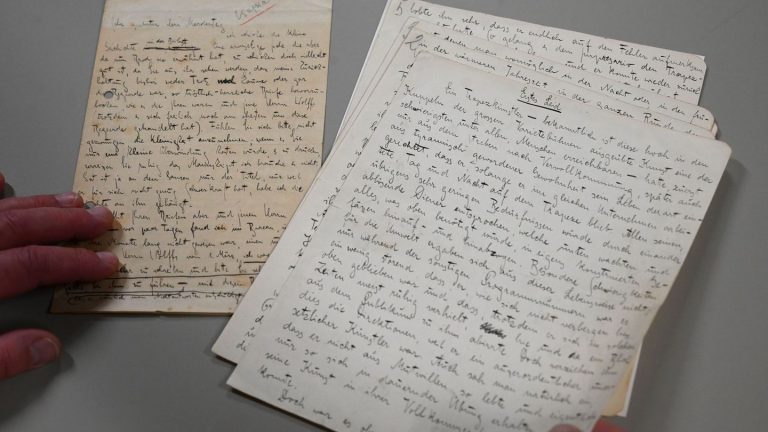Für Linkin Park gibt es wieder ein Morgen. Unser Autor sehnt sich nach seinem Gestern. Ein Brief an seine Jugend – und vor allem an Chester Bennington.
Lieber Chester,
es ist mir herzlich egal, was die Leute von Deiner Nachfolgerin halten. Die ist sie nicht, will sie auch gar nicht sein. Nein, diese Zeilen sind für mich, an Dich. Denn Du fehlst.
Genauer gesagt fehlt mir das Früher, in das mich Deine Stimme zuverlässig zurückbeamt. Damit bin ich nicht alleine. Jeder der 2,2 Milliarden Spotify-Klicks von „In the End“ ist eine gestreamte Erinnerung. Als würden wir uns die letzte Mailbox-Nachricht eines verlorenen Freundes anhören. Immer und immer und immer wieder. Um nicht zu vergessen, wie er war. Wie wir waren.
Es ist die Nostalgie der Millennials, ihre Sehnsucht nach dem Gestern, die Linkin Park auch nach Deinem Tod eine der erfolgreichsten Bands des Planeten hat bleiben lassen. Es ist Symbiose, Chester: Du hältst unsere Erinnerungen am Leben, wir Dein Vermächtnis.
Meine ganze Generation lernt gerade, dass sie ergraut, dass sie nicht mehr mitkommt, dass sie das Leben nicht mehr versteht, das da nachwächst. Deswegen wollten 14 Millionen Menschen die Gallagher-Brüder noch einmal live sehen. Sie hoffen auf einen Kurzurlaub in einem Land zu ihrer Zeit, in der objektiv nicht alles besser, aber subjektiv alles einfacher war. Oasis_Reunion 18.29
Linkin Park, das war Frustabbau als Audioformat
Für Dich war es nicht und niemals einfach. Trotzdem glaubte ich damals mit diesem teenagertypischen Narzissmus: Ich verstehe Dich, Chester – und viel wichtiger: Du, dieser Kerl mit den Flammentattoos auf den Unterarmen und der raufaserverkleideten Kehle, Du verstehst mich. Wenn Du von Wunden sangst, die nicht heilen wollen, war das, als würdest Du mich in den Arm nehmen, wenn kein anderer es tat.
Mit „Somewhere I Belong“ auf medizinisch bedenklicher Lautstärke starrte ich bei Fahrten in den Familienurlaub stundenlang aus dem Fenster, suhlte mich in dem, was ich unter Melancholie missverstand. „What I’ve Done“ hörte ich beim ersten Liebeskummer in Dauerschleife. Linkin Park mit Dir an der Front, das war Frustabbau als Audioformat, Küsse auf die Ohren und Balsam für die Seele.
Ich, dieses wohlstandsverwöhnte Vorstadtkerlchen, dessen Sorgen kaum über die nächste Mathe-Klausur hinausreichten, stellte meine banalen Sorgen mit Deinem seelenzerfressenden, am Ende tödlichen Kampf gleich. Du hast Deinen Schmerz aufgeschrieben, geschrien, auf Abermillionen CDs pressen lassen. Es klang, als würde ich einem Gefangenen dabei zuhören, wie er mit blutigen Fäusten auf die Wände seiner Zelle eindrischt. Mit eingängiger Melodie, klar. Ich bin Millennial. Heute wünsche ich mir, man hätte mich zum Sozialsein gezwungen 15.42
„Numb“ wurde retro. Schlimmer: Es wurde partytauglich
Als dann die ersten echten Lebenskrisen kamen, hatten Du und ich uns schon auseinandergelebt. Als wären zwei Kindheitsfreunde zum Studium in andere Städte gezogen, hätten erst die Themen, dann den Kontakt verloren.
Wenn ich in dieser Zeit Deine Stimme hörte, dann aus bassübersteuerten Anlagen im Club, bis kurz vor Unkenntlichkeit verzerrt. Du sangst wie früher von Taubheit und Verlorensein, jetzt grölte ich aus Leichtigkeit statt aus Wut mit, das schale Bier in der einen, die andere Hand gen niedriger Decke, an der sich der Schweiß der guten Laune sammelte. „Numb“ war partytauglich. Ein Hilfeschrei zum Feiern. Nächster Song: „Coco Jamboo“.
Jahre vergingen. Ich wurde nicht erwachsen, aber älter. Dann nahmst Du Dir das Leben. Ich trauerte. Nicht um Dich. Sondern um mich, um meine Jugend. Klingt erbärmlich, macht es aber nicht weniger wahr.
Dein Tod brachte mich Dir wieder näher. Heute höre ich Deine Stimme wieder öfter. Aber irgendwie anders, als läge ein Sepiaschleier darüber. Aber vergessen werde ich Dich nicht – und mich auch nicht.
Danke, Chester.
– ein Fan.
P.S.: Es stellt sich heraus: In the End it does matter.