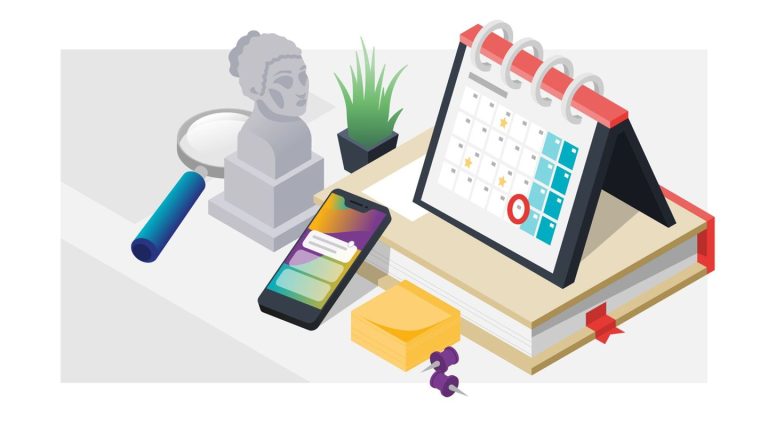Seit Jahren wird in baden-württembergischen Gewässern ein stiller Verdrängungskampf geführt. Flusskrebsarten aus den USA sorgen für ein Massensterben der heimischen Krustentiere.
Mal kommen sie in Bananenkisten über den Atlantik, mal werden fremde Tierarten auch unwissentlich ausgesetzt. Und mal führt sie der Mensch sogar absichtlich ein, verliert dann aber vollkommen die Kontrolle über den Bestand. So passiert beim nordamerikanischen Signalkrebs, der vor Jahrzehnten den Mangel an Speisekrebsen zunächst in Schweden ausgleichen sollte. Und der nun völlig unkontrolliert sein Unheil unter anderem in baden-württembergischen Gewässern anrichtet. Inzwischen bedroht der Signalkrebs landesweit heimische Arten wie den Stein- und den Edelkrebs, die es noch vor 200 Jahren massenweise in jedem Fluss, Tümpel und Graben gegeben hat.
Das Problem: Die eingeschleppten Signalkrebse übertragen die Krebspest, einen Pilz, der bei Flusskrebsen eine Krankheit auslöst. Nach Angaben der Fischereiforschungsstelle sind die Bestände invasiver Krebse zu etwa 80 Prozent durchseucht. Die amerikanischen Arten sind gegen die Pilzerkrankung größtenteils immun – ihre europäischen Verwandten hingegen sterben. Zudem vermehren sich die Signalkrebse früher und schneller als die einheimischen Flusskrebse und machen sich in denselben Lebensräumen wie sie breit.
Bestände der Flusskrebse werden ausgelöscht
„Beide Prozesse, die direkte Konkurrenz und Übertragung der Krebspest, führen in der Regel zu einer unumkehrbaren Auslöschung heimischer Flusskrebsbestände bei Anwesenheit des Signalkrebses“, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. In Baden-Württemberg hätten sich die Vorkommen bekannter Krebsarten in den vergangenen zwölf Jahren mehr als halbiert. „Mehr als zwei Drittel dieses Rückgangs wurden von invasiven Signalkrebsen oder auch durch die von diesen übertragene Krebspest verursacht“, heißt es in der Drucksache weiter.
Allerdings gelten Flusskrebse als ökologische Schlüsselorganismen. Sie haben großen Einfluss darauf, welche anderen Arten es in welcher Dichte in Gewässern gibt. Ziehen sie im Verdrängungswettbewerb gegen die importierten Verwandten den Kürzeren, verarmen die Gewässer.
Signalkrebse machen sich auch in kleinen Bächen breit
Das gilt nicht nur für die großen Flüsse. Denn der sehr aggressive und dem Edelkrebs relativ ähnlich sehende Signalkrebs dringt nach Angaben der Fischereiforschungsstelle in Langenargen (Bodenseekreis) auch immer mehr in kleinere Seitengewässer vor. Dort waren die heimischen Arten bisher eigentlich meist noch sicher. Vor allem der Dohlen- und der Steinkrebs seien von dieser Invasionswelle stark betroffen, hieß es.
„Signalkrebse sind für die heimischen Flusskrebsarten eine geradezu teuflische Angelegenheit“, sagt Jan Baer, Wissenschaftler an der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Es gebe Flusssysteme, die bereits verloren seien.
Also alles aussichtslos? Nicht ganz, auch wenn die Mittel gegen den Signalkrebs sehr eingeschränkt sind. Experten der Fischereiforschungsstelle vertrauen auf kleinere Wiederansiedlungen. Hoffnungen werden aber vor allem auf sogenannte Krebssperren gesetzt, also auf Hindernisse in Bachläufen, die das Ausbreiten der Invasoren verhindern sollen. „In vielen Fällen ist eine nachhaltige Eindämmung von Signalkrebsen durch Krebssperren die einzige erfolgversprechende Managementstrategie“, argumentiert das Ministerium. Die bislang 77 Sperren im Land seien vor allem in kleinen Oberläufen von Bächen relevant. Dort befänden sich noch die meisten Restbestände der streng geschützten Flusskrebsarten.
Signalkrebse schmecken auch gut
Natürlich kann man die Krebse auch fangen, kochen und verspeisen, weil die Krebspest für Menschen nicht schädlich ist. „Die schmecken sogar sehr gut“, meint Hilmar Grzesiak, der Fachbeauftragte für Fische beim NABU Baden-Württemberg. „Wenn Sie Scampis und Signalkrebse servieren, wird man kaum einen Unterschied erkennen.“ Aber eine Lösung ist das laut Ministerium nicht, es gebe viel zu viele davon und sie vermehrten sich zu schnell. „Für tatsächliche Effekte auf die Bestandsdichte sind sehr hohe Fangintensitäten notwendig, die für eine dauerhafte Wirkung endlos fortgeführt werden müssten“, heißt es dazu auch in der Drucksache.
Fischerei-Experte Baer hält den Einsatz mit allen Mitteln dennoch für geboten. „Wir haben eine Verantwortung und wir haben uns verpflichtet, die Bestände der heimischen Flusskrebse zu schützen“, sagt er. „Tun wir dies nicht, gehen Tierarten, die nur noch in unseren Gefilden heimisch sind, unwiderruflich verloren.“