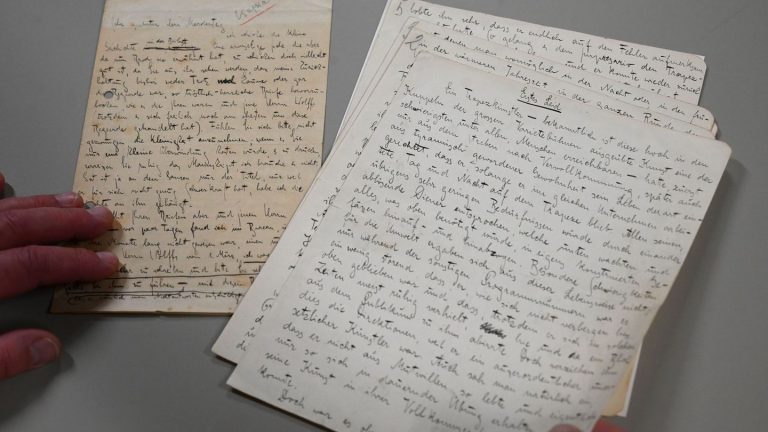Während der EM bietet das „Pride House“ in Berlin Public Viewing für queere Menschen an. Warum es das braucht und was für Erfahrungen die Community im Stadtion macht, erzählt die Projektleiterin Alice Drouin im Interview.
Das Public-Viewing-Angebot für die queere Community in Berlin heißt „Pride House“. Warum?
Das Konzept entstand eigentlich während der Olympischen Spiele. Dort gibt es schon lange Häuser während der Wettkämpfe, beispielsweise für verschiedene Nationen. Seit über zehn Jahren gibt es dort auch „Pride Häuser“. Daran angelehnt ist nun unser Public-Viewing-Konzept, dass es so in Deutschland nirgendwo anders gibt. Das Poststadion in Berlin ist nun Anlaufpunkt für die queere Community während der EM. Wir zeigen dort alle 51 Spiele. Drumherum gibt es Programm. Es wird also nicht nur Fußball geguckt, sondern sich informiert und ausgetauscht.
Wer darf kommen?
Alle. Natürlich wollen wir in erster Linie Menschen ansprechen, die zur queeren Community gehören. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche, und nicht-binäre Menschen. Wir laden aber auch alle Menschen ein, die sich als Verbündete verstehen. Das Konzept ist unter dem englischen Begriff „Allyship“ bekannt. Damit gemeint sind Leute, die nicht queer sind, aber solidarisch an unserer Seite stehen. Und neugierige Menschen sind natürlich auch herzlich eingeladen. Vor Ort haben wir professionell geschultes Personal, sollte es zu Problemen kommen.
Und wer kommt wirklich?
Überwiegend nehmen Berliner*innen das Angebot wahr. Wir hatten aber auch schon internationale Gäste, zum Beispiel schottische Fans, die extra wegen des Konzepts anreisten. Der Anlauf bei Deutschlandspielen ist aber am größten. Bei den letzten zwei Spielen waren je über 800 Menschen bei uns. Wie viele queer waren, wie viele „Allys“ oder Neugierige, das weiß ich nicht. Aus Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass darunter viele queere Menschen waren. Aber auch nicht-queere Familien kommen gern, beispielsweise weil weniger Alkohol getrunken wird. Außerdem wird bei uns weniger gegrölt und man steht nicht so eng beieinander. Es ist angenehmer für Menschen, die nicht so viele Reize ertragen können.
Das klingt fast so, als wäre das Fußball gucken im „Pride House“ eine stille, eher freudlose Angelegenheit.
Nein, die Stimmung ist einfach etwas entspannter. Bei uns gelten sieben Regeln und die siebte sagt: Hab Spaß und Freude. Natürlich sollen und wollen sich die Menschen an gutem Fußball erfreuen können. Natürlich wird bei uns auch gejubelt. Nur in einem Rahmen, in dem – das ist zum Beispiel eine andere Regel – Vielfalt geschätzt wird. Sport schließt einfach viele Menschen aus. Wir wollen queere Menschen mit dem Sport versöhnen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem sich jede Person als Teil der EM fühlen kann.
Man muss queere Menschen mit dem Sport versöhnen?
Nicht alle. Aber die queere Community erlebt viele Mikroaggressionen bis hin zu Diskriminierung. Viele haben schon im Schulsport schlechte Erfahrungen gemacht. Und bei den Angeboten für die große Masse gehen marginalisierten Personen unter – auch als Erwachsene. Denn es sind Orte, an denen der Standard gelebt wird. In Stadien oder bei anderen Public Viewings wird es oft körperlich, es gibt viele berauschte Menschen, viel Alkohol, teilweise Aggressionen. Man steht dicht aneinander. Damit fühlen sich längst nicht alle Menschen wohl.
Aber muss man sich deswegen absondern? Man könnte doch auch sensibilisieren, indem man sich zeigt und zeigt, wie es anders geht. Menschen, die vielleicht wenig Berührungspunkte haben, könnten die queere Community besser kennenlernen.
Und genau das passiert in unserem Pride House Berlin! Für die Zukunft würde ich mir auch wünschen, dass es keine besonderen Angebote mehr braucht. Das würde bedeuten, dass alle anderen Angebote gut genug durchdacht sind, sodass sich alle Menschen dort wohlfühlen. Solang das nicht der Fall ist, braucht es Ergänzungen. Damit jeder an einen Ort gehen kann, an dem er gern Fußball schaut. Wir haben auch überhaupt nichts gegen die anderen Angebote, wir wollen die nicht abschaffen. Nur sind viele queere Menschen einfach müde – und das ist noch das schwächste Wort, um das Gefühl zu beschreiben – davon, permanent schlechte Erfahrungen zu machen. Oder sie sind müde davon, immer andere aufzuklären.
Haben Sie Beispiele für konkrete Erfahrungen?
Dazu empfehle ich die Doku „Vielfalt im Stadion – Queere Fans“. Dort erzählt unter anderem eine trans Person, wie es für sie ist, ins Stadion zu gehen. Es fängt zum Beispiel damit an, dass dir die Ordner am Eingang ein Geschlecht zuordnen und du dann vielleicht von einem Mann abgetastet wirst, obwohl du eine Frau bist. Oder dass du nicht auf die Toilette gehen kannst, auf die du gern gehen würdest. Dann gibt es zum Beispiel Fangesänge mit transfeindlicher Wortwahl. Das mag in dem Fall nicht gegen die Person gerichtet sein, aber man weiß, dass man im Zweifel mitgemeint ist. Das tut weh. All das Finden vielleicht außenstehende Personen nicht schlimm, aber so etwas summiert sich. Es ist die Summe schlechter Erfahrungen, die das Leben zur Hölle macht.
Fühlen sich queere Menschen durch die EM besonders bedroht?
Man lebt generell latent mit dem Gefühl der Bedrohung. Das wird durch höhere Menschenaufkommen eher gesteigert. Aber während dieser EM ist auch Pride-Monat. Das ist für die Community die schönste Zeit des Jahres, denn queere Menschen sind eigentlich nie sichtbarer. Ich habe das Gefühl, dass sich das dadurch ein wenig ergänzt, das ist schön.
Pride-Monat und EM, das passt aus Ihrer Sicht also zusammen?
Ich glaube, es kann gut funktionieren. Zumindest auf dem Papier haben die beiden Ereignisse ja etwas gemeinsam: Das Miteinander, die Offenheit für Andere, die Freude andere kennenzulernen.