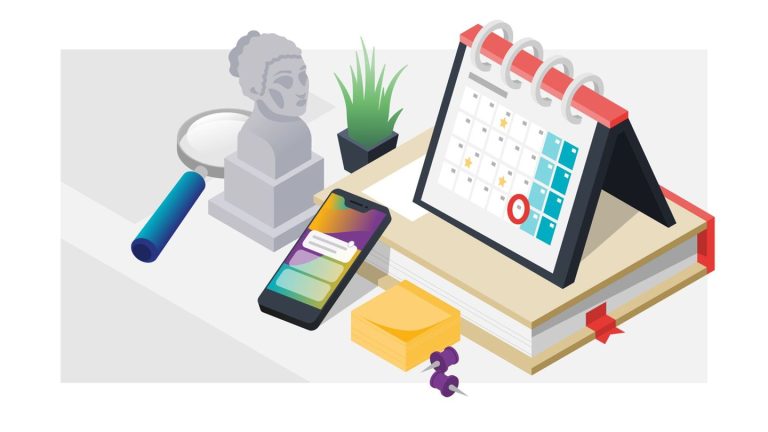Sie arbeitet als Stage-Managerin und hat über ungleiche Chancen in der Musikbranche geforscht. Nun fordert Rike van Kleef ein Grundeinkommen für Kulturschaffende.
Rike van Kleef, für ein Buch, an dem Sie aktuell arbeiten, haben Sie in den sozialen Medien Menschen aus dem Musikbetrieb aufgerufen, ihre negativen Erfahrungen zu schildern. Wie war der Rücklauf?
Enorm, ich konnte nicht einmal alle sprechen, die sich gemeldet hatten. Es zeigt, wie hoch der Gesprächsbedarf ist. Mir ist der Generationenunterschied besonders ins Auge gestochen. Viele, die am Anfang ihrer Karriere stehen, tun sich schwer, über Missstände zu sprechen, auch jene, die ganz oben stehen, sind weniger bereit, Probleme zu thematisieren. Insgesamt war mir wichtig, nicht nur mit Frauen und nicht-binären Menschen zu sprechen, denn auch Männer leiden unter patriarchalen Strukturen.
Sie haben Ihre Bachelor-Arbeit über mangelnde Gendergerechtigkeit geschrieben. Gibt es dazu noch weitere wissenschaftliche Arbeiten?
Sehr wenige, insbesondere in Deutschland. Ich komme aus der Musikindustrie und arbeite darin, sehe mich zudem als Aktivistin. In meinem Studium wollte ich mich wissenschaftlich mit den Strukturen befassen und stieß auf Leerstellen, daher begann ich selbst zu schreiben. In meinem Sachbuch, das im März kommenden Jahres veröffentlicht wird, will ich aufzeigen, dass der Machtmissbrauch nur ein Teil des Problems ist. Alles hängt miteinander zusammen und festigt ein strukturell diskriminierendes System. Für mich als cis Frau war es erschütternd zu erfahren, welch noch massiverer Diskriminierung nicht-binäre und trans Menschen ausgesetzt sind.
Nemo, der nonbinäre Mensch, der den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewonnen hat, ist im Netz großem Hass ausgesetzt. Waren wir da nicht schon einmal weiter?
In den Achtzigern gab es viele Künstler und Musikerinnen in der Öffentlichkeit, die queer waren und/oder mit Genderrollen brachen, Tracy Chapman zum Beispiel, Boy George oder David Bowie, den ich allerdings sehr kritisch sehe. Sie waren keine Randgruppe, sondern große Stars. Es ist schade, dass das so nachgelassen hat. Natürlich gibt es heute Nemo, Sam Smith, Kim Petras oder Troye Sivan, aber auf Festivals sind hauptsächlich weiße heterosexuelle Männer auf der Bühne. Festivals bedeuten Business, Männer machen mit anderen Männern Geschäfte.
1984 trat Freddie Mercury als offen schwuler Mann in Frauenkleidern staubsaugend auf und sang: „I want to break free“, ein Superhit. Was ist da passiert?
Wissenschaftlich wurde das meines Wissens bisher kaum betrachtet, wieso sich der Diskurs so verschoben hat. Es gab auch mal Zeiten, als geschlechtsangleichende Operationen als medizinischer Fortschritt gesehen und bejubelt wurden. Vielleicht ist es auch ein Resultat der Aids-Krise, in der insbesondere schwule Männer stigmatisiert wurden. Es gibt eine Re-Traditionalisierung, einen Vormarsch rechter Gruppierungen, das spielt vermutlich alles zusammen. Kaum einer wäre in den Achtzigern durchs Dorf gelaufen und hätte einem Jungen, der ein Kleid träg, gedroht, ihn aufzuschlitzen. Im Netz ist das gang und gäbe.
Der queere Popstar Boy George stellte in den Achtzigern die altgedienten Genderrollen infrage
© Rex Features/stern
Was hat sich durch die Rammstein-Affäre verändert?
Allen wurde klar, dass diese Enthüllungen für viele wenig überraschend waren. Für Frauen und queere Menschen war es besonders belastend, wie damit umgegangen wurde. Ich erinnere mich an Zoom-Konferenzen mit Kolleginnen, in denen in den ersten zehn Minuten nur geweint wurde, weil alle den Umgang damit so schlimm fanden. Es war für alle klar geworden, dass im Zweifelsfall auch wir ungeschützt sind, dass auch wenn uns etwas zustoßen würde, keine Konsequenzen folgen.
Der Sänger Chilly Gonzales empfiehlt im stern-Interview, bei zweifelhaften Charakteren, deren Musik man liebt, das Werk vom Künstler zu trennen. Er nennt R. Kelly und Kanye West. Geht das?
Nein, man kann das Werk nicht vom Künstler trennen, denn solange dieser lebt, profitiert der Künstler von dem Erfolg des Werkes. Wir müssen diese Mentalität aus dem vergangenen Jahrhundert loswerden, diesen männlichen Geniekult überwinden. Nach wie vor wird die Schuld Betroffenen zugeschoben, anstatt das Idol zu hinterfragen. Immer noch hört man Sätze wie „die dummen Groupies hätten doch wissen können, was sie erwartet, selber schuld, wenn sie zu Backstagepartys gehen“.
Sind blauäugige Groupies tatsächlich Teil des Problems?
Erstens mag ich diesen Begriff nicht, Groupies klingt schon abwertend und kommt aus dem gefährlichen „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“-Mythos. Man hat David Bowie stets verziehen, dass er an „Baby Groupies“ auf Drogen sexuelle Handlungen vollzogen hat. Ein Idol zu treffen, ist niemals das automatische Zugeständnis zu Sex. Viele wissen eben nicht, dass sie als Sexobjekte vorgeführt werden. Sex ist hier ein Machtinstrument, ich finde das wirklich erschreckend. Auch deutsche Bands wie Tokio Hotel oder die Killerpilze haben erzählt, was früher nach ihren Konzerten abgelaufen ist, wobei hier auch die Rolle der Manager betrachtet werden müsste, die Musiker waren ja damals teilweise selbst noch minderjährig. Ein Hauptproblem ist natürlich, dass die Musikszene so massiv von Alkohol und Drogen bestimmt ist.
Rock-Konzerte gelten als Orte von Euphorie und Ekstase. Müssen wir diese Freiheit opfern?
Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Machen wir diesen Freiraum nicht auch kaputt, wenn sich die Hälfte der Menschen dort nicht sicher fühlen darf? Mehr Rücksichtnahme und Sicherheit für schwarze Menschen, queere, nonbinäre und Frauen macht niemanden unfrei. Wenn dein Ausleben dazu führt, dass sich andere nicht wohlfühlen, wer bist du dann? Verhaltensregeln sind keine absurden Einschränkungen, sondern die Basis einer funktionierenden Gesellschaft.
Wie gelingt das, was sollte sich ändern?
Ein Faktor sind diese dezentralen Strukturen, die vielen selbständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit deren unterschiedlichen Bedürfnissen muss sich dringend auseinandergesetzt werden. Es bedarf einer Diversifizierung der Teams, und wir brauchen Verhaltensregeln sowie Ansprechpersonen für Awareness hinter den Kulissen. Die Arbeitsbedingungen sind im gesamten Kulturbereich teils extrem prekär. Die Branche ist netzwerkgetrieben. Wer Kritik äußert, läuft Gefahr, seine Aufträge zu verlieren, hier braucht es Schutz. Zusammengefasst: Es wäre an der Zeit unsere gesamte Kulturpolitik zu ändern.
Und zwar wie?
Ein Blick nach Frankreich lohnt sich. Wer dort ein gewisses Berufsniveau nachweisen kann, erhält dort ein Grundeinkommen. Es würde das gesamte Grundgefühl dieser Branche verändern, wenn die permanente Existenzangst wegfallen würde. Wer nicht weiß, wie er seine Miete zahlen soll, hat keine Entscheidungsfreiheit, für wen er arbeiten möchte und für wen nicht. Es ist aber wichtig, Nein sagen zu können, wenn man sich in einer Produktion nicht wohlfühlt.